Bildquelle: #214187834 | Urheber: Alexander Limbach
Hinweis: Der nachfolgende Text erschien zunächst auf Infosperber.ch, einer journalistischen Online-Zeitung aus der Schweiz. Auch Der-Demokratieblog bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum und unterstützt deshalb die Vielfalt alternativer Medien!
Makers and Takers: So haben die Banken die Macht übernommen
Der «Bauch» weiss es schon lange, hier sind die Fakten: Die Finanzindustrie schädigt die reale Wirtschaft und schafft Armut.
15. August 2018
von Christian Müller
Um es gleich vorwegzunehmen: Für mich, der ich als Journalist nicht nur die geopolitischen Winkelzüge und offenkundigen Machtkämpfe auf dieser Welt mitverfolge, sondern auch die gesellschaftspolitischen Veränderungen in Ost und West aufmerksam beobachte, ist das Buch von Rana Foroohar, «Makers and Takers; Der Aufstieg des Finanzwesens und der Absturz der Realwirtschaft», das interessanteste all der Bücher, die ich in diesem Jahr schon gelesen habe. Da werden einem in vielen Punkten und anhand realer Beispiele richtig die Augen geöffnet.
Rana Foroohar, geboren 1970, ist von ihrer beruflichen Vergangenheit her eine Spezialistin im Finanzwesen, war zuerst selber in der Finanzindustrie tätig, dann mehrere Jahre Korrespondentin des Time Magazine mit Sitz in London und zuständig für die Berichterstattung über Europa, und ist seit 2017 Kolumnistin der Financial Times. Schon in der Einleitung ihres Buches über die «Makers», die arbeiten, und die «Takers», die nur nehmen, erzählt sie ein ganz persönliches Erlebnis im Gespräch mit Polit- und Finanzexperten, das dazu führte, dass sie, wie sie schreibt, dieses Buch schreiben musste.
Und so ist das Buch denn auch geworden: Es ist das Bekenntnis einer engagierten Frau, die nicht länger nur zusehen wollte und will, wie sich das internationale Finanzsystem entwickelt und wie mehr und mehr die Banken die Macht über diese Welt übernommen haben. Mit vielen konkreten Fällen, die das sichtbar machen. Wobei man bei der Lektüre daran denken muss, dass Rana Foroohar primär die US-amerikanischen Verhältnisse beschreibt. Nur: Europa ist seit Jahrzehnten dabei, alles zu übernehmen, was aus den USA kommt. Warum sollte Europa gerade in diesem Punkt aus seiner eigenen und der US-amerikanischen Geschichte lernen und einen eigenen Weg beschreiten? Es gibt kaum Anzeichen dafür.
Wofür sind die Banken da?
Rana Foroohar – sie hat eine eigene Website – beschreibt anschaulich, wofür die Banken früher da waren und wofür sie eigentlich immer noch da sein sollten: als Dienstleister der Realwirtschaft. Man gibt einem Unternehmen, das investieren muss oder will, einen Kredit. Heute wird das Geld nicht mehr primär für realwirtschaftliche Investitionen eingesetzt, sondern zur Steigerung der Profitabilität der Unternehmen, sprich: vor allem zur Wertsteigerung der Aktien, zum Beispiel durch Rückkauf von Aktien durch das Unternehmen selbst, oder wie auch immer. Die Autorin des Buches «Makers and Takers» nennt diesen Wandel die Finanzialisierung. Und sie erklärt das so (alle hier wiedergegebenen Zitate stammen aus der deutschsprachigen Ausgabe des Buches):
«Die Krankheit unserer Wirtschaft hat einen Namen: Finanzialisierung. Dieser Begriff bezeichnet die Tendenz, dass die Wall Street und ihre Denkweise in den Vereinigten Staaten zur unangefochtenen Herrschaft gelangt sind. Sie durchdringt nicht nur die Finanzindustrie, sondern die gesamte amerikanische Unternehmenswelt. Genau die Art von kurzfristigem, riskantem Denken, das im Jahr 2008 beinahe die Weltwirtschaft zusammenbrechen liess, verbreitert heute die Kluft zwischen Arm und Reich, hemmt das Vorankommen der Wirtschaft und bedroht die Zukunft des amerikanischen Traums als solchem.
Die Finanzialisierung Amerikas schliesst alles ein, von Umfang und Tragweite der Finanzaktivität in unserer Volkswirtschaft über das verstärkte Aufkommen von schuldengespeister Spekulation auf Kosten der produktiven Kreditvergabe, den Aufstieg des Shareholder-Values als Modell für gute Unternehmensführung, die Ausbreitung riskanten, eigennützigen Denkens im privatwirtschaftlichen und öffentlichen Sektor, die wachsende politische Macht von Finanziers sowie der Vorstandsvorsitzenden, die sie bereichern, bis hin zu der Tatsache, dass die Ideologie nach dem Motto ‹Die Märkte wissen es am besten› auch dann noch der Status quo bleibt, nachdem sie die schlimmste Finanzkrise seit 75 Jahren ausgelöst hat.»
Das Buch ist kein Buch, das nur Finanzfachleute verstehen. Es kann zwar tatsächlich auch zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden, hat es doch im Anhang fast 700 Fussnoten mit den Quellenangaben zu den im Text erwähnten Fakten. Aber geschrieben ist es leichtverständlich, oft sogar mit den in den amerikanischen Büchern üblichen Wiederholungen und Redundanzen. In den USA erschien das Buch unter dem Titel «Makers and Takers; How Wall Street Destroyed Main Street».
Ich lasse (mit Bewilligung des Verlages Plassen der deutschsprachigen Ausgabe) ein Kapitel aus der Einführung folgen. Anschliessend zitiere ich Rana Foroohars eigene Vorschau auf die im Buch genauer behandelten konkreten Fälle.
Das Ende des Wachstums und die wachsende Ungleichheit
«Unsere Finanziers und Politiker brüsten sich gerne damit, dass Amerika die breitesten und tiefsten Kapitalmärkte der Welt besitzt. Doch im Gegensatz zu der herrschenden Meinung der letzten Jahrzehnte ist das nichts Gutes. Dieses ganze Finanzwesen hat uns nämlich nicht wohlhabender gemacht. Vielmehr hat es die Ungleichheit vertieft und ein Mehr an Finanzkrisen in Gang gebracht, die jedes Mal beträchtliche ökonomische Werte vernichten. Das Finanzwesen ist weit davon entfernt, unserer Wirtschaft eine Hilfe zu sein. Stattdessen ist es zu einem Hemmnis geworden. Mehr Finanzwesen steigert unser Wirtschaftswachstum nicht – sondern bremst es.
Studien zeigen in der Tat, dass Länder mit grossen und schnell wachsenden Finanzsystemen tendenziell ein geringeres Produktivitätswachstum aufweisen. Wenn man bedenkt, dass im Grunde das Zusammenspiel von Produktivität und Demografie das Rezept für wirtschaftlichen Fortschritt darstellt, ist das ein enormes Problem. Eine einflussreiche, von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) veröffentlichte Schrift formulierte diesen Sachverhalt recht plastisch. Darin wird gefragt, ob ein ‹aufgeblähtes Finanzsystem› nicht wie eine Person sei, ‹die zu viel isst› und den Rest der Wirtschaft bremst. Die Antwort lautet: Ja – und tatsächlich setzen die nachteiligen Auswirkungen des Finanzwesens bereits ein, wenn es nur halb so gross ist wie das der Vereinigten Staaten. Berichte von Vereinigungen wie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oder des Internationalen Währungsfonds (IWF) kommen zu einem ähnlichen Schluss: Die Branche, die eigentlich die Zahnräder des Wachstums ölen sollte, ist stattdessen zu Sand im Getriebe geworden.
Zunehmende Monopolisierung
Zum Teil rührt diese nachteilige Wirkung vom Rückgang der Unternehmensgründungen und der ökonomischen Aktivität her, die mit dem Wachstum des Finanzwesens einhergingen. Zum anderen Teil hat sie mit der zunehmenden Monopolmacht der Grossbanken zu tun, deren Anteil an allen Bank-Vermögenswerten sich seit Anfang der 1970er-Jahre mehr als verdreifacht hat. (Amerikas fünf grösste Banken machen jetzt die Hälfte seiner Handelsbanken-Branche aus.) Diese wachsende Dominanz bedeutet, dass die Finanzinstitute das Geld zunehmend dorthin schleusen können, wohin sie möchten, also eher in Richtung Schulden und Spekulationen als in produktive Investitionen, bei denen es länger dauert, bis man einen Profit ernten kann. Macht – hinsichtlich der Grösse und des Einflusses – ist auch der Grund, weshalb die Finanzlobby so effektiv ist. Die Finanzwirtschaft gibt regelmässig mehr Geld für die Lobbyarbeit in Washington aus als alle anderen Branchen. Dies hat sie in die Lage versetzt, entscheidende Bereiche der Regulierung zurückzudrehen [ ] und unsere steuerlichen und sonstigen Gesetze nach Gutdünken zu ändern. Die Macht dieser grossen oligopolistischen Interessen verwandelt unsere einmalige amerikanische Ausprägung des Kapitalismus zunehmend in eine Vetternwirtschaft, die besser zu einer Autokratie der Dritten Welt als zu einer angeblichen Demokratie mit freier Marktwirtschaft passt. Dank dieser Veränderungen wird unsere Volkswirtschaft nach und nach zu einem ‹Nullsummenspiel zwischen Eigentümern von Finanzvermögen und dem Rest Amerikas›, wie es der ehemalige Goldman-Sachs-Banker Wallace Turbeville ausdrückte, der bei dem Nonprofit-Thinktank Demos ein mehrjähriges Projekt über die Finanzialisierung leitet.
Zunehmende Ungleichheit zwischen Reich und Arm
Eine der schädlichsten Auswirkungen des Aufstiegs des Finanzwesens ist eine Zunahme der massiven Ungleichheit, wie wir sie seit dem Gilded Age (dem «Goldenen Zeitalter», ab 1870, Red.) nicht mehr erlebt haben. Tatsächlich verlaufen diese beiden Trends synchron. Die Gehälter im Finanzsektor – eine einfache Möglichkeit, das Verhältnis der beiden Variablen zu verfolgen – waren im Vorfeld des Börsencrashs 1929 im Verhältnis zu allen anderen Löhnen hoch und fielen dann, nachdem die Banken wieder reguliert worden waren, in den 1930er-Jahren rasant. Ab den 1980er-Jahren stiegen sie wieder drastisch, nachdem die Finanzwirtschaft erneut von der Leine gelassen worden war. Der Anteil von Finanziers am obersten Prozent der Einkommensverteilung hat sich von 1979 bis 2005 annähernd verdoppelt.
Die reichen Banker sind allerdings weniger der Grund für die Ungleichheit als vielmehr das frappierendste anschauliche Anzeichen dafür, wie bedeutend das Finanzvermögen für die sich verbreiternde Wohlstandskluft in Amerika geworden ist. Die Finanziers und die von ihnen bereicherten Supermanager der Unternehmen stellen gerade deswegen einen wachsenden Anteil an der Elite der Nation, weil sie die meisten Finanzmittel kontrollieren. Diese Vermögenswerte (Aktien, Anleihen und so weiter) sind bei den Privilegiertesten die vorherrschende Form von Vermögen und dadurch kommt ein Schneeballeffekt der Einkommensungleichheit zustande. Wie der französische Volkswirt Thomas Piketty in seinem 696 Seiten starken Werk ‹Das Kapital im 21. Jahrhundert› ausführlich erklärt, überwiegen die Renditen aus Finanzanlagen bei Weitem diejenigen aus altmodischer Arbeit gegen Lohn oder Gehalt. Selbst wenn man die Gehälter der Topmanager der modernen Wirtschaft betrachtet – der Vorstandsvorsitzenden, Banker, Bilanzbuchhalter, Agenten, Berater und Anwälte, gegen die Gruppierungen wie Occupy Wall Street wettern –, muss man unbedingt bedenken, dass sie 30 bis 80 Prozent ihres Einkommens nicht in bar, sondern in Form von anreizgesteuerten Aktienbezugsrechten und Aktien erhalten.
Auf diese Art des Einkommens fallen viel weniger Steuern an, als die meisten von uns auf ihr regelmässiges Gehalt bezahlen – dank der finanzfreundlichen Änderungen des Steuerrechts in den letzten gut 30 Jahren. Das bedeutet, dass die Zusammensetzung der Vergütung der Topmanager den Anteil dramatisch reduziert, den der öffentliche Sektor vom landesweiten Vermögenskuchen bekommt (und damit auch die Fähigkeit des Staates, den ärmeren Schichten und der Mittelschicht unter die Arme zu greifen), und gleichzeitig die Einkommenskluft in der gesamten Wirtschaft verbreitert. Die 25 bestverdienenden Hedgefonds-Manager Amerikas verdienen mehr als sämtliche Erzieherinnen und Erzieher des Landes (der USA, Red.) zusammen – eine Statistik, die wie keine andere die ungleiche Ressourcenverteilung widerspiegelt, die untrennbar mit der Finanzialisierung zusammenhängt.
Die Abwärtsspirale beschleunigt sich
Diese Abwärtsspirale beschleunigt sich noch, wenn Führungskräfte, die in Aktien bezahlt werden, kurzfristig orientierte Entscheidungen treffen, die womöglich das Wachstum ihrer Unternehmen schwächen, während sie dadurch den Wert ihrer eigenen Bezugsrechte steigern. Es ist kein Zufall, dass die Aktienrückkäufe, die meist zwar die Aktienkurse, nicht aber das zugrunde liegende Wachstum aufbessern, und die Bezahlung von Managern in den vier vergangenen Jahrzehnten gleichlaufend gestiegen sind. Zahlreiche Studien veranschaulichen diese Überschneidung der Finanzialisierung und der Wohlstandskluft. Eine der schlagendsten wurde von den Volkswirten James Galbraith und Travis Hale erstellt. Sie zeigten, dass die Veränderung der Einkommensungleichheit Ende der 1990er-Jahre zu einem bemerkenswerten Grad dem munter steigenden Aktienindex Nasdaq Composite folgte. Gleiches geschah während des Aktienbooms der letzten Jahre, was den Punkt unterstreicht, den Kommentatoren – wie zum Beispiel der Journalist Robert Frank – angesprochen haben: dass Vermögen, das an Finanzmärkten aufgebaut wird, ‹stärker von der wirklichen Welt abstrahiert› und daher grösseren Schwankungen unterworfen ist und dass dies einen Zyklus aus Auf- und Abschwüngen fördert (der natürlich die Armen stärker schädigt als alle anderen).
Piketty zeigte in seinem Buch deutlich, dass die Finanzialisierung – falls keine einschneidenden Ereignisse wie Kriege oder schwere Depressionen eintreten, die den Wert von Finanzanlagen vernichten – dafür sorgt, dass die Reichen wirklich reicher, und zwar viel reicher, werden, während es den anderen immer schlechter geht. Das ist nicht nur für diejenigen am unteren Ende schlecht, sondern für uns alle. Untersuchungen belegen, dass mehr Ungleichheit zu schlechterem Gesundheitszustand führt, zu geringerem Vertrauen, zu mehr Gewaltverbrechen und weniger sozialer Mobilität – lauter Dinge, die eine Gesellschaft instabil machen können. Piketty erklärte mir 2014 in einem Interview, es gebe ‹keinen Algorithmus›, um vorherzusagen, wann Revolutionen passieren. Wenn sich die gegenwärtigen Trends jedoch fortsetzen würden, könnten die Konsequenzen für die Gesellschaft in Gestalt sozialer Unruhen und wirtschaftlicher Umwälzungen ‹schreckenerregend› werden.
Die Zahlen sprechen für sich
Es gibt viele konservative Gelehrte, Politiker und Geschäftsleute (sowie Liberale, die an den Trickle-Down-Effekt glauben), die die Einzelheiten einer solchen Analyse bestreiten werden. Man kann durchaus argumentieren, präzise und unwiderlegliche Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen dem Finanzwesen und dem Wachstum des Pro-Kopf-BIPs seien wegen der gewaltigen Anzahl von Variablen, die dabei mitspielen, schwer zu isolieren. Doch die Tiefe und Breite der Korrelationen zwischen dem Aufstieg der Finanzwirtschaft und der Zunahme der Ungleichheit, dem Rückgang der Unternehmensgründungen, den stagnierenden Löhnen und den Funktionsstörungen der Politik sprechen sehr dafür, dass das Finanzwesen nicht nur Boden gutmacht, sondern auch aktiv auf die Realwirtschaft drückt. Dazu kommt noch, dass dies die Volatilität der Märkte deutlich erhöht und damit auch das Risiko von Ereignissen wie der Grossen Rezession, die 16 Billionen Dollar Haushaltsvermögen vernichtete. Es lässt sich nachweisen, dass die Anzahl der Vermögen vernichtenden Finanzkrisen in den letzten Jahrzehnten im Gleichschritt mit dem Wachstum des Finanzsektors zugenommen hat.
Die Wissenschaftler Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff erläutern in ihrem Buch ‹Dieses Mal ist alles anders: Acht Jahrhunderte Finanzkrisen›, dass der Anteil der Welt, der von Bankenkrisen betroffen wurde (gewichtet nach dem Anteil der jeweiligen Länder am globalen BIP), von circa 7,5 Prozent im Jahr 1971 auf 11 Prozent im Jahr 1980 und auf 32 Prozent im Jahr 2007 gestiegen ist. Und der Volkswirt Robert Aliber äusserte 2005, also deutlich vor der Kernschmelze des Jahres 2008, in einer Neuauflage eines der massgeblichen Bücher über Finanzblasen – ‹Manien, Paniken, Crashs: Eine Geschichte der Finanzkrisen der Welt› des verstorbenen Charles Kindleberger – eine ernste Warnung: ‹Daraus lässt sich unmissverständlich schliessen, dass Finanzpleiten in den letzten 30 Jahren ausgedehnter und allgegenwärtiger waren als in allen anderen vorherigen Zeiträumen.›
Dies veranschaulicht auf frappierende Weise, dass sich die Finanzwirtschaft von einer Branche, die zum Eingehen gesunder Risiken ermuntert, zu einer Branche gewandelt hat, die einfach nur Schulden schöpft und unproduktive Risiken über das gesamte Marktsystem verteilt.»
(Ende dieses leicht gekürzten Kapitels; die Zwischenüberschriften hat der Autor dieser Rezension gesetzt)
Rana Foroohar sagt in der Einleitung, was viele Autoren von Fachbüchern tun, auch ziemlich konkret, worüber sie auf den restlichen 340 Seiten des Buches berichtet. Ich lasse diesen Vorschau-Passus hier ebenfalls wörtlich folgen, in der Hoffnung, dass sich nicht zuletzt unsere Politiker und Politikerinnen die Zeit nehmen, die eine oder andere Geschichte in Rana Foroohars ‹Makers and Takers› selber zu lesen.
Im Folgenden Rana Foroohars Vorschau (wörtlich):
«In dem Bemühen, auch den interessierten Laien mitzunehmen und den einschläfernden Ton vieler wissenschaftlicher und wirtschaftswissenschaftlicher Bücher zu vermeiden, die über die Jahre Teile des Problems angepackt haben, habe ich ‹Makers and Takers› als Abfolge von Geschichten über die Unternehmen und die Menschen gestaltet, die in den letzten hundert Jahren im Zentrum der Finanzialisierung standen. Sie sind keineswegs die einzigen Vertreter der tektonischen Verschiebung, die im Gange ist, aber sie gehören zu den besten und interessantesten. Ich hoffe, dadurch, dass ich den Schwerpunkt auf echte Menschen und Unternehmen lege, deren Existenz von der Finanzialisierung betroffen war oder ist – gewöhnlich zum Schlechteren –, unsere Überlegungen zu diesem Thema in einer Weise auf den Boden der Tatsachen zurückholen zu können, die eine gesündere Debatte fördert.
Kapitel 1 erklärt den Aufstieg des Finanzwesens an sich. Wie kam es dazu, dass eine Branche, die nur vier Prozent der Arbeitsplätze stellt, für ein Viertel aller Unternehmensgewinne verantwortlich ist? Diese Geschichte wird aus der Perspektive der ersten Bank des Landes erzählt, die als ‹too big to fail› galt, nämlich der Citigroup.
Kapitel 2 untersucht, wie die finanzorientierte Denkweise im amerikanischen Wirtschaftsleben vorherrschend wurde, indem es die Geschichte von General Motors und dem ehemaligen Verteidigungsminister Robert McNamara sowie der Whiz Kids erzählt. Deren Zahlenbesessenheit trug entscheidend dazu bei, dass Amerika den Vietnamkrieg verlor, dass es mit seiner Autoindustrie bergab ging und dass sich das finanzielle Denken inzwischen in alle Winkel der amerikanischen Unternehmenswelt ausgebreitet hat.
Kapitel 3 befasst sich intensiv mit der wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung in den Vereinigten Staaten und damit, wie und warum sie sich heute auf die Manipulation von Bilanzen konzentriert und echte Manager-Kompetenzen ignoriert.
Kapitel 4 entzaubert unsere herrschende Auffassung vom Shareholder-Value, indem es sich anschaut, wie aktivistische Investoren wie Carl Icahn mittlerweile bei den grössten und erfolgreichsten Unternehmen des Landes – zum Beispiel bei Apple – das Sagen haben, was auf Kosten der Innovationstätigkeit und der Schaffung von Arbeitsplätzen geht.
Kapitel 5 zeigt auf, welch grosser Teil der amerikanischen Unternehmenswelt inzwischen das Bankwesen nachahmt – und dass wir heute alle ruhmreiche Banker sind –, indem es die Geschichte von General Electric nachzeichnet. Es ist zwar einer der grössten amerikanischen Innovatoren, wurde aber zur fünftgrössten Bank des Landes, bevor es versuchte, sich auf seine industriellen Wurzeln zurückzubesinnen.
Kapitel 6 legt den Schwerpunkt auf einen der gefährlichsten Bereiche des Finanzsektors – die Derivate. Es zeigt anhand der Erzählung von Goldman Sachs und seiner Manipulation des Rohstoffmarkts, dass heutzutage Banken die Kontrolle über die natürlichen Ressourcen ausüben, auf die Unternehmen und Verbraucher angewiesen sind. Und es zeigt, was dies für die Preise der Waren bedeutet, die der durchschnittliche Amerikaner täglich konsumiert.
Kapitel 7 erzählt, wie es dazu kam, dass einer der lukrativsten und undurchsichtigsten Bereiche des Finanzwesens, der Private-Equity-Sektor, den wichtigsten Sektor unserer Wirtschaft dominiert, nämlich den Wohnungsmarkt – und so der typisch amerikanische Traum, ein Eigenheim zu besitzen, für viele amerikanische Mittelschichtsfamilien zur trügerischen Fantasie wurde.
Kapitel 8 schaut sich an, wie die Privatisierung unseres Rentensystems es ermöglichte, dass die Vermögensverwaltung – der am schnellsten wachsende Sektor des Finanzwesens – sich an unnötigen Gebühren bereichert und wie die Investmentfonds-Branche im Grunde unsere Ersparnisse verspielt.
Kapitel 9 legt dar, wie und warum es dazu kam, dass unser Steuersystem Unternehmen gegenüber natürlichen Personen bevorzugt, dass es eher Schulden als Eigenkapital fördert und dass es Konzernen wie Pfizer ermöglicht, Financial Engineering als Geschäftsstrategie zu betreiben.
Kapitel 10 analysiert, wie die Finanzkultur und die Drehtür zwischen der Wall Street und Washington es so schwer gemacht haben, das Rad der Finanzialisierung zurückzudrehen, und weshalb so viele Reformen, die nach der Kernschmelze 2008 versprochen wurden, immer noch nicht umgesetzt worden sind.
Das Rad der Finanzialisierung zurückzudrehen mag zwar schwer sein, doch es ist keinesfalls unmöglich. Kapitel 11 stellt Lösungsmassnahmen vor, die sich auf Gespräche mit Menschen aus der ersten Reihe von Industrie, Wissenschaft und Staat gründen und das Finanzwesen wieder in den Dienst der Realwirtschaft stellen könnten. Dabei werde ich im gesamten Verlauf des Buches nicht nur Geschichten von ‹Kassierern› skizzieren, sondern auch von ‹Machern›, sowie die Lektionen, die unsereins von Unternehmen und Führungspersönlichkeiten lernen können, die ‹es richtig machen›.»
Dr. Christian Müller
… ist Journalist und Redakteur in der Schweiz. Von 1979 bis 1988 war er Verlagsleiter, dann Chefredakteur bei den Luzerner Neusten Nachrichten. Von 2003 bis 2009 war Dr. Müller Chief Executive Officer der Vogt-Schild-Mediengruppe in Solothurn. Seit 2009 ist er wieder als freier Journalist tätig. Dr. Müller ist seit 2011 Mitglied der Redaktionsleitung der Schweizer Internet-Zeitung Infosperber.ch. Weiterhin ist er Präsident der Vereinigung Weltföderalisten Schweiz.


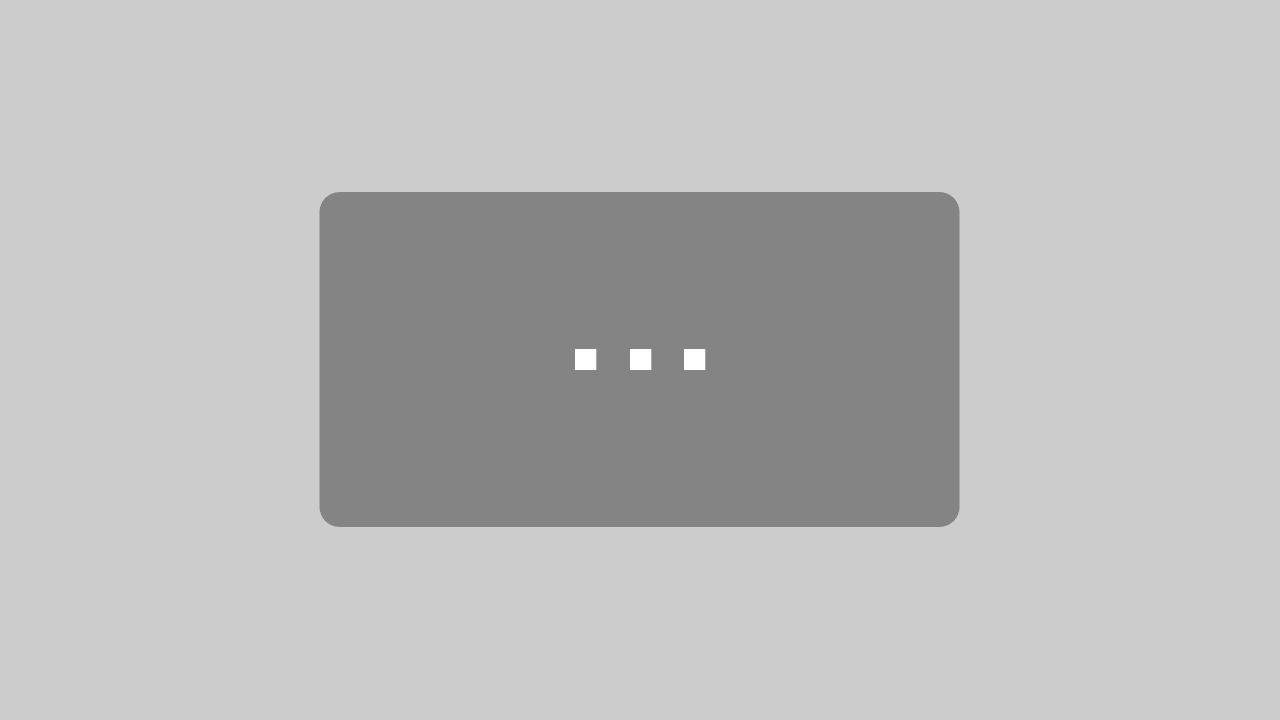


Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!